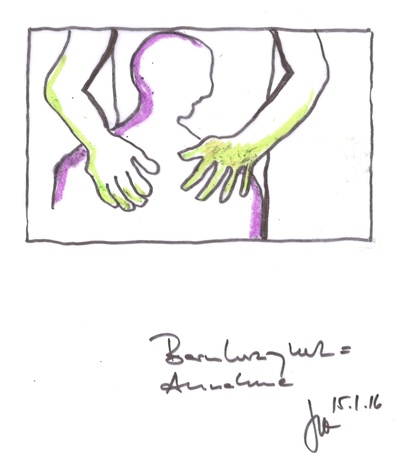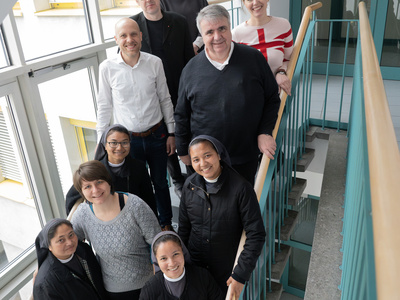Die Predigt im Wortlaut:
„Infrastruktur“ ist das große Schlagwort. Es beherrscht derzeit die Diskussion in unserem Land.
„Infrastruktur – damit sind primär Straßen, Brücken, Schienennetz, Eisenbahn, Personennahverkehr und Post, Telekommunikation, schnelles Internet, Energieversorgung, ebenso öffentliche Gebäude wie Kindergärten und Schulen gemeint u.s.w.
„Infrastruktur – dazu zählen auch die Anliegen von Klimaschutz sowie ganz aktuell und höchst brisant Verteidigung und Rüstung.
Wie das alles finanziert werden kann, dazu erleben wir derzeit den öffentlich ausgetragenen Disput – in der Politik, zwischen den Parteien und Verbänden und insbesondere in den Medien mit ihren teils kontroversen Kommentaren. Klar ist, dass simple, platte, verkürzte Parolen und plakative Sprüche keine Lösung beinhalten und deshalb nicht helfen. Sie verstärken allenfalls Spannungen, erzeugen Misstrauen und vertiefen Gräben.
„Infrastruktur – bei allen derzeitigen Diskussionen – und das merke nicht nur ich als Caritas-Verantwortlicher – kommen kaum soziale Belange sowie die Anliegen sozialer Dienste und Einrichtung vor. Insofern war ich sehr hellhörig, als ich im Radio einen Kommentator im Blick auf das riesige Finanzpaket hörte, der anmerkte: „Geld allein bewirkt nichts!“
In der Tat – noch so große Geldsummen sind keine Garantie, dass dadurch die Lebenssituation in unserer Gesellschaft verbessert wird. Deshalb halte ich auch den Vorschlag, zur Finanzierung einen Feiertag zu streichen, nicht für zielführend. Denn gerade jetzt kommt es auf die innere Einstellung der Menschen und den verantwortungsbewussten Zusammenhalt und einen menschenwürdigen Umgang miteinander in der Gesellschaft an. Und Feiertage, wenn sie sich vom Werktag, vom Alltag abheben, haben die Chance, dass sie zur Besinnung einladen, nachdenkliche Botschaften vermitteln und das Miteinander in Familie und Gesellschaft stärken.
Deshalb ist es sehr erhellend, die derzeitige Situation in unserem Land vor dem Hintergrund des heutigen Evangeliums zu bedenken! Denn auch hier geht es um eigenwillige Zukunftsplanung, um ein möglichst luxuriöses Leben, ebenso um Neid und Missgunst, sowie letztlich das bemerkenswerte Verhalten des Vaters. Blicken wir deshalb auf den jüngeren und den älteren Sohn sowie den Vater.
Zunächst geht unser Blick auf den jüngeren Sohn:
- An ihm wird deutlich, dass es nicht die Strukturen waren, die ihn eingeengt und zum Fehlverhalten verleitet haben. Er hat andere, sehr eigenwillige Vorstellungen vom Leben. Er will genießen.
- Das Gleichnis macht deutlich, dass Gott uns Menschen absolute Freiheit lässt. Wir haben sogar die Freiheit, uns gegen ihn zu entscheiden. Aber wir müssen dann auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, auf uns nehmen.
- Das Gleichnis macht schließlich deutlich, dass der jüngere Sohn sehr lange gebraucht hat, bis er eingesehen hat, dass er sein Leben nicht so und auch nicht allein in den Griff bekommt. In der Überzeugung, selbst in der Lage zu sein, für sein Lebensglück zu sorgen, setzt er sich ab. Der Vater musste ihm seine Eskapaden finanzieren. Als dann aber sein Weg gescheitert ist, ist er zunächst zu stolz, auf den vertrauten und bewährten Weg zurück zu seinem Vater zu gehen und um Hilfe zu bitten. Sein Fehler, den er jetzt begeht, ist der falsche Stolz, der es ihm nicht erlaubt umzukehren und sich helfen zu lassen.
- Entscheidend ist letztlich die Erkenntnis, dass es ihm bei seinem Vater wesentlich besser ging und gehen wird, als auf dem eigenwillig eingeschlagenen Weg.
Das Gleichnis Jesu ist aber auch interessant im Blick auf den älteren Sohn:
- Während der jüngere sich mehr und mehr vom Vater entfernt, dann aber – Dank besserer Einsicht – zu ihm zurückkehrt, setzt sich der ältere Sohn durch seinen Neid und seine Missgunst vom Vater ab. Der ältere Sohn glaubt, der bessere zu sein. Er hat keine Freude an der Gemeinschaft, in der auch Platz ist für diejenigen, die Fehler gemacht haben.
Schließlich ist das Verhalten des Vaters bemerkenswert:
- Der Vater überzeugt den Sohn nicht durch Vorhaltungen, was er falsch gemacht hat. Er gewinnt den Sohn zurück durch seine überwältigende Offenheit. Es geschieht im besten Sinne des Wortes „Ver-söhn-ung“. So wird der jüngere sogar zur Bereicherung für das Haus. Das lässt sich der Vater etwas kosten.
Jesus macht deutlich: Gott will uns zum Leben und zum Glück verhelfen – auch nach Um- oder Irrwegen. Dabei denkt, entscheidet und handelt er völlig anders als wir Menschen. Nicht mit unseren Wie-du-mir-so-ich-dir-Vorstellungen, sondern mit Liebe und Barmherzigkeit wird er den Menschen letztlich gerecht.
Dieses Gleichnis, das uns unter der Überschrift „Der verlorene Sohn“ seit Kindertagen bekannt ist, wurde in unserem Theologiestudium „Der barmherzige Vater“ genannt. Nach meiner bisherigen Lebenserfahrung meine ich, es sollte als „Das Gleichnis von der grenzenlosen Liebe des Vaters“ überschrieben werden.
Durch das Verhalten des Vaters will Jesus seinen Zuhörern deutlich machen: Ich kann im Leben gar nicht mehr haben, als bei Gott geborgen zu sein und aus der Nähe zu IHM heraus zu leben und zu handeln sowie durch IHN Gemeinschaft und Geborgenheit und Halt zu erfahren. Und es geht mir absolut nichts verloren, wenn ich einem anderen gönne, dass auch er das Erbarmen und die Güte Gottes spüren darf.
Jesus will mit seinem Gleichnis aber nicht nur auf Einzelfälle anspielen. Er will uns grundsätzlich aufmerksam machen, wo wir auch als Gesellschaft Gefahr laufen, uns von Gott zu entfernen, nämlich
- wenn wir uns verhalten wie der jüngere Sohn, der denkt, ohne Gott und nach eigenen Vorstellungen, nach eigenem Lebensmuster glücklicher zu werden sowie in der scharfen Abgrenzung zu anderen,
- oder wenn wir uns verhalten wie der ältere Sohn, der sich durch seinen Neid, seine Missgunst, durch seine zu kurz gegriffenen und vielleicht sogar verbissenen Vorstellungen von Gerechtigkeit sich selbst um sein Glück und seine Lebensfreude bringt.
Jeder von uns kann sich eigensinnig verrennen und vertraute Wege aufgeben. Jeder von uns kann sich aber auch um sein Glück bringen, nur weil er es anderen neidet und ihnen missgönnt, dass es ihnen ebenso gut geht. Jesus will uns ermuntern, dass wir wie der Vater bereit sind zum Verzeihen, zu Barmherzigkeit, zur „Ver-söhn-ung“ und zum Brücken bauen.
Der Vater hat gewiss nicht die Irrwege gutgeheißen, aber er hat dem jüngeren Sohn zu besserer Einsicht verholfen. Er hat damit auch die Hoffnung, die der jüngere zu guter Letzt auf den Vater gesetzt hat, nicht enttäuscht.
Vor diesem Hintergrund will ich unsere Überlegungen zurückführen auf die eingangs erwähnte Situation, der maroden „Infrastruktur: Diese mit noch so viel Geld aufzumöbeln, wird nicht sicherstellen, dass dann das Leben des Einzelnen wie auch das Zusammenleben in unserem Land und unsere Mitverantwortung für die Weltgemeinschaft besser sein wird.
Zum Gelingen des Lebens gehört zuvorderst die innere Einstellung, dass es im Leben nicht nur um das eigenwillige Herausholen und Genießen geht. Es ist die Bereitschaft notwendig, Verantwortung zu übernehmen und das Leben mit all seinen Aufgaben so zu meistern, dass daraus ein gutes Miteinander erwächst. Dazu braucht es stets die Offenheit, das eigene Tun zu reflektieren und nicht gleich irgendwelche Strukturen verantwortlich zu machen für ungenügende Zustände.
Schließlich kann Gemeinschaft und damit Gesellschaft nur gelingen, wenn die Bereitschaft besteht, denen, die auf Abwegen sind und ihre Irrwege erkannt haben, die Möglichkeit zur Rückkehr offenhalten.
Ein beherztes, engagiertes und „ver-söhn-tes“ Miteinander möchte ich als die wichtige „Infrastruktur“ bezeichnen. Auf dieser Grundlage kann dann auch ein menschliches, hoffnungserfülltes und friedvolles Miteinander entstehen.
Domkapitular Clemens Bieber
www.caritas-wuerzburg.de
Text zur Besinnung
Ein Anstoß oder anders gesagt:
ein vielleicht sogar anstößiger Gedanke von Lothar Zenetti:
Dem Luder ein Bruder
Dem ärmsten Hund
dem verlassensten Luder
wurde er Bruder. –
So war es zu lesen
in einem Text, den einer
als Entwurf einsandte
im Wettbewerb für
neue Kirchenlieder.
Nein, hieß es, das
geht nicht – Luder, das
geht zu weit, das
sagt man einfach nicht.
Sagten sie damals
nicht ähnlich:
Jesus, das geht nicht,
diesen Menschen
Bruder sein, das geht
zu weit, das
macht man einfach nicht.
Aber er machte es.
Sein Leben reimte Bruder
auf Luder.
Er glaubte daran.
Er musste dran glauben.
(Lothar Zenetti)